BNE – Ein Überblick
(Nijhawan, 2024; Wals & Keift, 2010; United Nations, 2016; Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2016; KMK, 2024; de Haan, 2007)
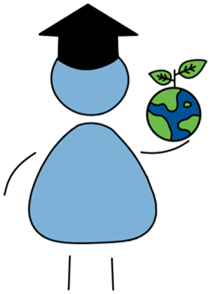
Mit der Erfindung der Dampfmaschine kam es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer rasant ansteigenden Entwicklung der Technik und Industrie. Als Folge dessen wurden zahlreiche Rohstoffe wie z.B. Holz, Kohle, Luft, Boden, Wasser in viel größeren Mengen genutzt und verbraucht. Die ökologischen Nebenwirkungen dieser rasanten Entwicklung wurden schließlich nach und nach wahrgenommen, was das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung verstärkte.
Auch wenn die Idee, Nachhaltigkeit in Bildung zu integrieren, bereits im 18. Jahrhundert aufkam (Nijhawan, 2024), so wird als Anfang eines institutionalisierten Versuchs, Bildung für Nachhaltige Entwicklung curricular zu implementieren, zumeist in den internationalen UN-Konferenzen für Umwelt und Entwicklung in den Jahren 1972, 1977, 1992 gesehen (Wals & Keift, 2010). Insbesondere bei der UN-Konferenz ‚on Environment and Development‘ in Rio de Janeiro. Dort bekennen sich erstmals mehr als 1200 Vertreter aus 112 Staaten zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit.

Auf dieser Konferenz verabschiedeten die Staaten einen Aktionsplan mit 109 Handlungsempfehlungen. Diese Entwicklungen setzten sich auf zahlreichen Folgekonferenzen fort, bis im Rahmen der 2030-Agenda beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York 17 Ziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) verabschiedet und von 169 Staaten unterzeichnet wurden (United Nations, 2016).
Diese Ziele sollen für alle Länder ein geltendes globales und anwendbares Zielsystem für Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsaspekte darstellen.

Abbildung: Eigene Darstellung der 17 SDGs (United Nations, 2017).
Bildung für Nachhaltige Entwicklung im deutschen Chemieunterricht
Auch im deutschen Bildungssystem besteht die Forderung der Integration einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in die Curricula wie z.B. im Rahmen des Nationalen Aktionsplan BNE (2017) (u.a. auch Orientierungsrahmen global, 2016; Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2016; KMK, 2024) oder durch die Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule (2024). Diese definiert BNE folgendermaßen:

Die Definition der KMK macht deutlich, dass es bei einer BNE nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern vor allem auch um Kompetenzen geht, die Lernende dazu befähigen, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen.
Im deutschsprachigen BNE-Diskus finden sich im Wesentlichen zwei Kompetenzkonzepte:
- Gestaltungskompetenz nach de Haan. (2007)
- Kompetenzen nach dem Orientierungsrahmen der KMK. (2024)
Bei den Entwicklungen der Unterrichtsmaterialien in diesem Modul wurde insbesondere der Orientierungsrahmen der KMK als Grundlage verwendet, um eine optimale Vereinbarkeit mit dem Curriculum zu ermöglichen. Die Kultusministerkonferenz unterscheidet in ihrem Orientierungsrahmen zwischen 11 Kernkompetenzen, basierend auf drei Kompetenzbereichen: Erkennen, Bewerten und Handeln.
Im Rahmen der Entwicklungen und Forderungen auf internationaler und nationaler Ebene nimmt das Thema BNE auch im Chemieunterricht eine immer wichtigere Rolle ein, was sich auch in der zunehmenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit BNE in der chemiedidaktischen Forschung widerspiegelt (Forster & Koenen, 2022; Ibraj et al., 2024). Die Implementation von BNE in einem schulischen Kontext steht jedoch noch am Anfang. Die in diesem Modul vorgestellten Beispiele sollen dazu beitragen, Themen mit Bezug zur BNE verstärkt in den Unterricht zu integrieren.

© Zerouali, A., Brinkmann, J., Frömmel, M. & Koenen, J. (2024) Toolbox Lehrerbildung – ViFoNet Fortbildungsmodul: BNE – Ein Überblick. (URL).